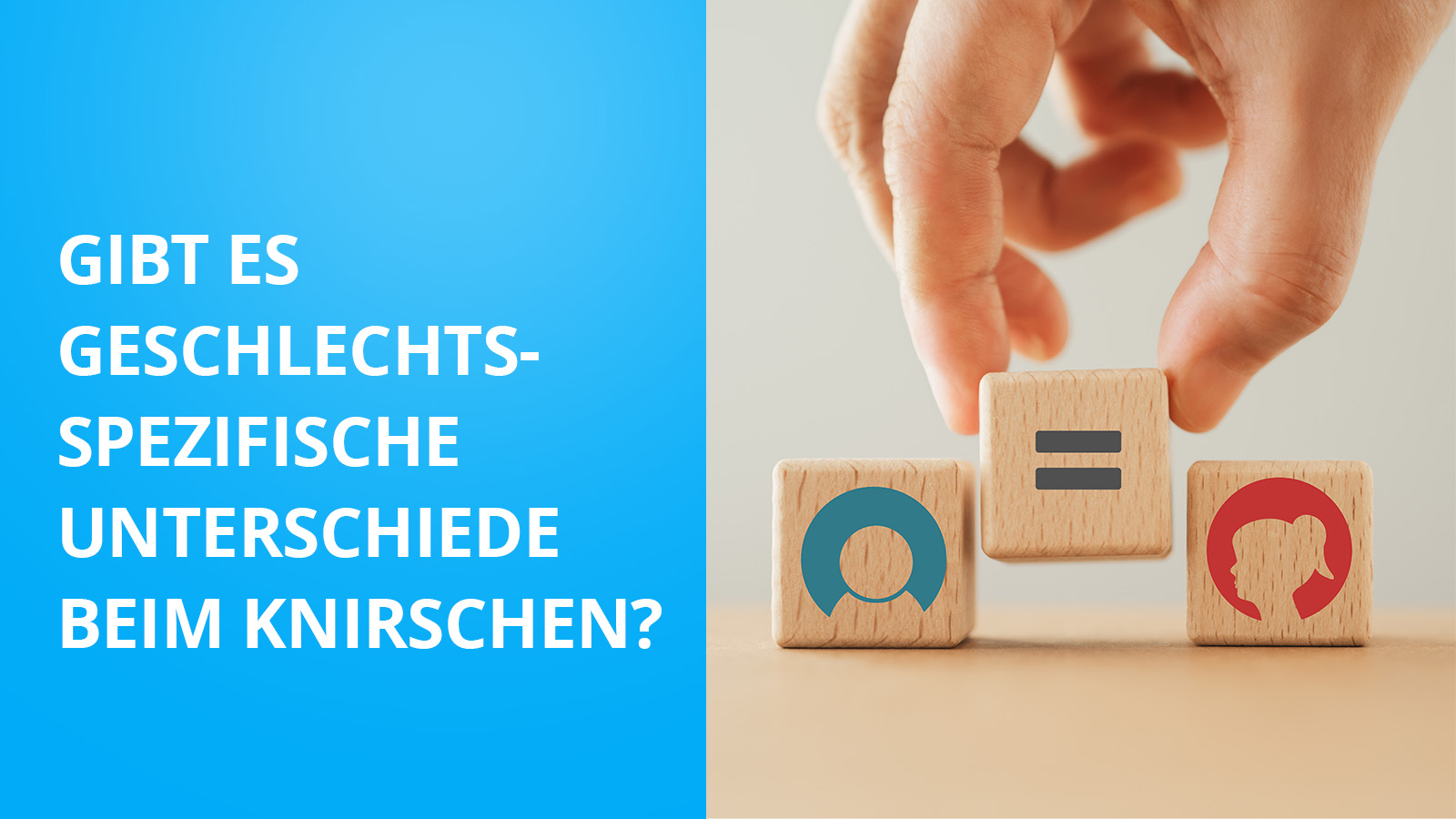Patientenzufriedenheit und Shared Decision Making
Im ersten Teil der Shared Decision Making Reihe haben wir Ihnen einen Teil der Ergebnisse der Bertelsmann Studie vorgestellt. Dabei ging es um die Wünsche, die PatientInnen bezüglich der Entscheidungsfindung für ihre Therapien haben. Hier erfahren Sie, welche bestimmten Einflussfaktoren diesen geäußerten Wünschen zu Grunde liegen.
Über 55 % der Menschen wünschen sich eine partizipative Entscheidungsfindung mit ihrer Ärztin/ihrem Arzt und möchten von diesem die wichtigsten Informationen erfahren sowie ihre Fragen beantwortet haben. Daraus ergibt sich die Wichtigkeit von Shared Decision Making: Es vergrößert die Erfolgschance einer Behandlung, steigert die Patientenzufriedenheit und senkt die Chance einer Fehldiagnose.
Einflussfaktoren für unterschiedliche PatientInnenwünsche
Nachdem aus dem ersten Artikel deutlich geworden ist, wie die Menschen zur partizipativen Entscheidungsfindung (oder Shared Decision Making) stehen und wie dieses Modell funktioniert, bleibt aber offen, welche Faktoren genau in die geäußerten Wünsche mithineinspielen. Sind es Faktoren wie Alter, soziales Geschlecht oder Gesundheitsbefinden? Schließlich lässt es vermuten, dass ältere PatientInnen noch eher nach dem paternalistischen Ansatz behandelt werden möchte als jüngere PatientInnen, die gerne auch selbstbestimmt sind und gut informiert. Vielleicht spielen gar sozio-ökonomische Gründe eine Rolle, persönliche Präferenzen oder etwa Persönlichkeitsmerkmale? [2]
Die Ergebnisse der Gesundheitsmonitor-Erhebungen von 2001-2008
Um genau diese spannenden Ansätze zu untersuchen, wurden die bereits vorliegenden Daten der Gesundheitsmonitor-Erhebungen von 2001-2008 herangezogen und unabhängige Aspekte in Form von sozialstatistischen Daten (Alter, Geschlecht, Schulbildung, Versichertenstatus (GKV/PKV) sowie Morbiditätsdaten (Selbsteinstufung des Gesundheitszustands, chronische Erkrankung, Häufigkeit der Hausarztbesuche) in die Analyse mitaufgenommen. [2]
Die Daten wurden jeweils in zwei Gruppen miteinander verglichen. Also jeweils eine Gruppe mit Befragten einer Option (Arzt/Ärztin entscheidet, gemeinsame Entscheidung, PatientIn entscheidet) gegenüber allen anderen Befragten. Daraus ergaben sich folgende Ergebnisse:
Die Resultate
(Darstellung adaptiert nach Tabelle 1: Einflussfaktoren des Originaltextes [2])
Alleinige Entscheidungsfindung des Arztes
- Überwiegend ältere Befragte (60+) entscheiden dafür
- Befragte mit niedriger Schulbildung (34 %)
- Patienten, die sehr häufig Arztbesuche hatten. [2]
- Nur 17 % der jüngeren Befragten mit hohem Schulabschluss wollen die Entscheidung allein dem Arzt überlassen.
Gemeinsamen Entscheidungsfindung
Hier zeigt sich in der Tendenz ein konträres Bild: Die gemeinsame Entscheidungsfindung wird von Befragten mit höherem Bildungsniveau deutlich häufiger genannt, von Älteren dagegen seltener.
Die Zustimmung zu dieser Option:
- 48 Prozent bei Hauptschulabsolventen
- 52 Prozent bei Befragten mit mittlerer Reife
- 58 Prozent bei Abiturienten und Befragten mit Fachhochschulreife. [2]
Frauen und chronisch Kranke wollen eher weniger die Regie Ihrer Therapie aus der Hand geben und agieren deutlich selbstbewusster in diesem Zusammenhang.
Es liegt die Vermutung nahe, dass der Frau immer noch die Rolle als Gesundheitsberaterin in der Familie zufällt. Wohingegen bei chronisch Kranken das intensivere beziehungsweise bedrohlichere Erleben der Krankheit eine Rolle dafür spielen dürfte, dass sie zumindest eine Beteiligung an der Entscheidung zur Therapie wünschen. [2]
Autonome Entscheidungsfindung der Patienten
Diese Option in der Auswahl lässt sich nur schwer beantworten. Es lässt sich keine eindeutige Gruppe identifizieren. Es treten jedoch die Merkmale wie
– “Lebensalter” (18-39 Jahre)
– “Geschlecht” (Frauen etwas eher als Männer) und
– “fehlender oder geringer Hausarztkontakt”
hervor. Es ist aber zu vermuten, dass für die Wahl gewisser Optionen Persönlichkeitsmerkmale eine Rolle spielen [2,3]. Patienten lassen sich hier in verschiedene Kategorien einteilen, in der Art und Weise, wie diese mit Gesundheitsinformationen und den Arztempfehlungen umgehen [3]. Ein niedriger oder höherer Bildungsabschluss bedeuten also nicht zwingend ein niedrigeres oder höheres Maß an Selbstbewusstsein.
Fazit: Nicht alle wollen das Gleiche
Anhand dieser Ergebnisse zeigt sich, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, die eine Rolle spielen, wenn es um eine partizipative Entscheidungsfindung beim Arzt geht. Hier sollten auch Sie als Ärztinnen und Ärzte Fingerspitzengefühl beweisen und vorher abklopfen, in welche Richtung der Patient/die Patientin tendiert. Persönliche Ansprache und das Gefühl sehr individuell behandelt zu werden, geben den PatientInnen ein gutes Gefühl. Das bringt eine Extraportion vertrauen und erhöht die Erfolgschancen einer Akzeptanz der vorgeschlagenen Maßnahmen. Das Portfolio von Orehab Minds gibt Ihnen mit den Digital Report BRUX, CEPH, CONDY und CHEW die Möglichkeit, die Kommunikation mit Ihren Patienten zu erleichtern und so Zufriedenheit und Vertrauen zu stärken.
Lesen Sie auch Teil 1 und Teil 3 zu Shared Decision Making.
Die komplette Studie finden Sie hier:
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/publikationen/publikation/did/partizipative-entscheidungsfindung-beim-arzt?
[1] Stiftung Gesundheitswissen
Auf Augenhöhe mit dem Arzt? (7.02.2018)
[2] Braun B & Marstedt G. Partizipative Entscheidungsfindung beim Arzt. Anspruch und Wirklichkeit. 2012.
[3] Boston Consulting Group. Vital Signs Update: The E-Health Patient Paradox, BCG Focus, 20.05.2001.
[4] Gesetz zur Verbesserung der Rechte von Patientinnen und Patienten. Vom 20. Februar 2013. Bundesgesetzblatt Jahrgang 2013 Teil I Nr. 9, ausgegeben zu Bonn am 25. Februar 2013.