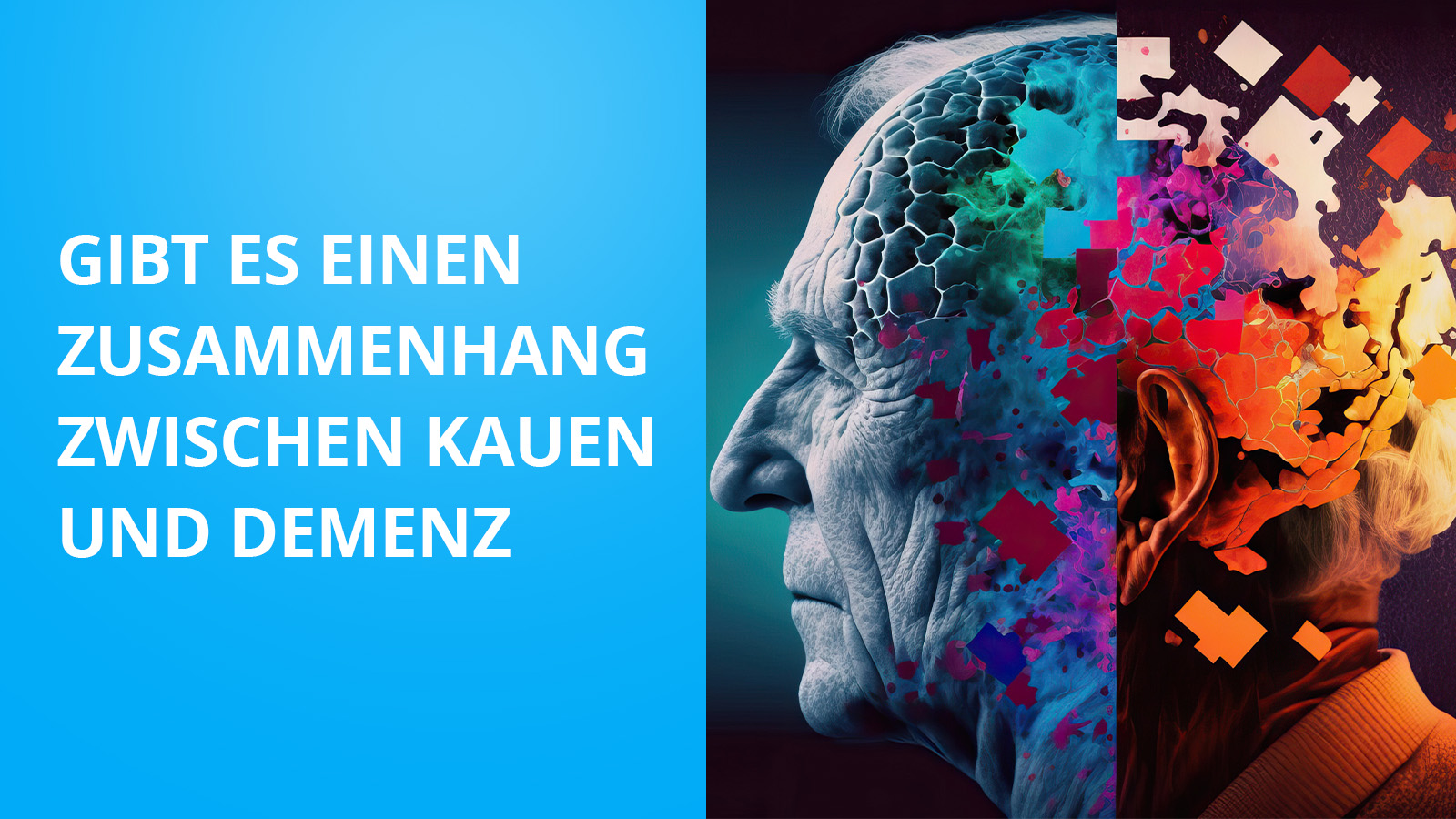Dass Sie diese Frage mit einem Nein beantworten, ist aus meiner Sicht eher unwahrscheinlich. Wenn wir die Bruxismus-Prävalenz in einer der gesunden erwachsenen Bevölkerung auf Basis des Selbstreports mit 20% bis 30% annehmen, und die Zahl der Menschen hinzufügen, die knirschen und pressen, jedoch nicht selber erkennen, mit geschätzten 30% dazurechnen, dann sind wahrscheinlich 2/3 Ihrer Patient*innen Zähneknirscher. Bei Kindern liegt der Prozentsatz noch höher, hier berichten die meisten Eltern von Bruxismus-Episoden der Kinder im Schlaf. Wenn also die Mehrheit die oben gestellte Frage bejaht, dann gibt es zumindest eine gute Nachricht: Wir lernen das Bruxieren immer besser zu verstehen.
Obwohl die Einschätzung des Bruxismus in den letzten Jahren eine Paradigmenwechsel erfahren hat und nicht mehr ausschließlich als abzustellende schädliche Abart verstanden wird, so ist der klinische Fokus nach wie vor auf mögliche negative Folgen gerichtet: Absplitterungen, okklusales Trauma, Zahnwanderungen, Kopfschmerzen, Nackenverspannungen, temporo-mandibuläre Dysfunktion. [1]
Patient*innen sind, sobald subjektive Symptome auftreten, naturgemäß an einer zahnärztlichen Abklärung interessiert. Im aktuellen internationalen Konsens wird gefordert, dass der subjektiv wahrgenommene Bruxismus durch eine instrumentelle Analyse bestätigt wird. [2]
Der Einsatz von instrumentellen Analysen ist in der Zahnheilkunde bekannt und in vielen Zahnarztpraxen Routine. Bevor Sie jetzt aber das Interesse verlieren, weil es zu sehr nach Funktionsdiagnostik im klassischen Sinn klingt, gleich der Hinweis: Hier ist von den Autor*innen in erster Linie die sogenannte Polysomnographie im Schlaflabor gemeint – da der Bruxismus in der Schlafmedizin zu den schlafbezogenen motorischen Störungen hinzugerechnet wird. [3]
Und damit stoßen wir selbstverständlich unmittelbar an die Grenzen der praktischen Umsetzung. Es ist einfach nicht möglich, jeden unserer Patient*innen mit Verdacht auf Knirschen und/oder Pressen ins Schlaflabor zu überweisen. Es fehlt schlichtweg an Ressourcen. Außerdem schätze ich das Verständnis Ihrer Patient*innen in Bezug auf eine solche Maßnahme als äußerst gering ein. Und, auch Zahnärzte knirschen und pressen, nicht nur im Schlaf, sondern auch tagsüber, wenn wir fokussiert präzise Tätigkeiten im Mund unserer Patient*innen durchführen. Und es ist mir nicht bekannt, dass all jene bruxierenden Kolleg*innen regelmäßig im Schlaflabor übernachten.
Welche Instrumente können wir nun in der täglichen Praxis anwenden? Es gibt unterschiedliche technologische Ansätze, von der Messung der Muskelaktivität über die Krafteinwirkung auf mit Sensoren ausgerüsteten Schienen bis hin zum Bestimmen jener Zahnkontakte, die bei einer willkürlichen Bewegung auftreten. Zur Verifizierung des (Schlaf-)Bruxismus sind solche Ansätze nur sehr eingeschränkt geeignet, da die Messung in einem völlig anderen Umfeld und in einem völlig anderen Zustand des Patient*innen vorgenommen wird: Aufrecht in einem Behandlungsstuhl sitzend, im Wachzustand, mit einem intraoral platzierten großen Messinstrument, aufgefordert artifizielle Exerzierbewegungen durchzuführen. Dies unterscheidet sich doch sehr von einer wechselnden Schlafposition mit unterschiedlichen Kopfhaltungen. Aber gerade für diese Situationen (unbewusstes Knirschen in der individuellen Schlafposition) haben wir ein sehr geeignetes Instrument, die BRUX CHECKER® Folie zu Verfügung. [4, 5]
Und die Interpretation des BRUX CHECKER® wird uns mittels den DRS BRUX Reports ohne großen Aufwand ins Haus geliefert, Patientenaufklärung und Dokumentation inklusive.
Lassen Sie sich überraschen, wie einfach ein BRUX CHECKER® zu verstehen ist!
Der BRUX CHECKER® wird tiefgezogen, wobei zu beachten ist, dass die mit der Lebensmittelfarbe beschichtete Seite außen liegt (es haben sich schon einige Kolleg*innen gewundert, dass offensichtlich knirschende Patient*innen gar keine Abriebstellen auf der BRUX CHECKER® Folie zeigt, leider lag das aber an der falschen Herstellung – ein typisches Beispiel von Murphys Gesetz). Aber wenn das beachtet wird, dann kann nichts schiefgehen. Die Patient*innen werden instruiert – vor dem Schlafengehen die Folie auf die Zähne aufzustecken, an diesem Abend keine aggressive Zahnpasta und keinen Alkohol konsumieren, am nächsten Tag vor dem Zähneputzen wieder herausnehmen und in der Praxis abgeben.
Die Analyse erfolgt automatisiert: In der Praxis wird der BRUX CHECKER® mit einem hellweißen Silikon ausgefüllt (verbessert auch gleichzeitig die Stabilität), es wird ein standardisiertes Foto in der DRS Box erstellt und mithilfe einer speziellen KI gestützten Software von Orehab Minds ausgewertet. Binnen weniger Minuten und ohne großen Aufwand ist der Report DRS BRUX mit allen erforderlichen Informationen zurück.
Zunächst sollten Sie sich auf Anzahl und Größe der Abriebstellen fokussieren: Daran lässt sich ein quantitativer Eindruck gewinnen, und mit den Normwerten, die Orehab Minds laufend verfeinert, vergleichen. Alle hier aufgeführten Daten beziehen sich auf den Oberkiefer. Daten für den UK- BRUX CHECKER® liegen ebenfalls vor.
Wissen Sie, wie viele Abriebstellen durchschnittlich junge beschwerdefreie Erwachsene in einer Nacht „produzieren“?
Es sind mehr als Sie wahrscheinlich vermuten: 28.
Die Anzahl hat mich persönlich überrascht. Die Spannweite reicht von 10 bis 38. Also können wir bereits eine Erkenntnis ableiten: Je weniger desto besser stimmt nicht.
Wissen Sie, wie groß Abriebstellen durchschnittlich sind, die junge beschwerdefreie Erwachsene in einer Nacht „produzieren“?
Hier liegen die Werte weit auseinander: Von 12 bis 220mm2.
Hier zeigt sich das individuelle Knirschverhalten viel deutlicher. Die Flächen sind umso größer, je flacher die okklusalen Strukturen sind. Also können wir zweite Erkenntnis ableiten: Viele, aber kleine Abriebstellen sind wesentlich besser als wenige große.
Vermuten Sie deutliche Unterschiede zwischen den Abriebstellen von Frauen und Männern?
Es zeigen erste Daten, dass die Unterschiede gering sind: Anzahl f=27 vs. m=29 bzw. Fläche f=56mm2 vs. m=87mm2.
Unsere dritte Erkenntnis: geschlechterspezifische Unterschiede sind zunächst vernachlässigbar.
Wie schätzen Sie die Seitenverteilung der Abriebstellen Rechts-Links ein: symmetrisch, deutlich asymmetrisch, einseitig?
Hier sind die Daten eindeutig: Wir können von einer nahezu symmetrischen Verteilung ausgehen.
Unsere vierte Erkenntnis: 28 Abriebstellen teilen sich in der lateralen Verteilung gleichmäßig in 14 rechts und 14 links auf.
Schlussendlich, was erwarten Sie in der sagittalen Verteilung?
Auch hier dürfen wir auf unser grundsätzliches Okklusionsverständnis vertrauen: Front-Eckzahnführung und gute seitliche Abstützung.
Unsere fünfte Erkenntnis: Die Abriebstellen verteilen sich anterior – intermediär – posterior in einem Verhältnis von 30%:25%:45%.
Diese Informationen erhalten Sie automatisiert in Form von PDF-Dateien im Digital Report BRUX – und für den Patienten verständlich dargestellt. Im ersten Schritt der systematischen Analyse eines BRUX CHECKERS® wird die quantitative Beurteilung vorgenommen (Abb. 1):
Abbildung 1: Zur Unterstützung des quantitativen Verstehens des BruxCheckers® – die numerische Analyse der Abriebstellen (DRS BRUX Elemente Wertetabelle und Kennzahlen).
Im zweiten Schritt der systematischen Analyse eines BRUX CHECKERS® wird die qualitative Beurteilungvorgenommen (Abb. 2):
Abbildung 2: Zur Unterstützung der qualitativen Analyse des BruxCheckers(r) – die lateral und sagittale Verteilung (hier: Anzahl der Abriebstellen). Interpretation: die rechts-links Verteilung ist mit 9:7 Abriebstellen nahezu symmetrisch, die sagittale Verteilung zeigt ein deutliches Defizit posterioren Abschnitt auf beiden Seiten. (CRS BRUX Elemente Aufnahme, Seite R. vs L. und Abschnitt anterior:intermediär:posterior]
Im dritten Schritt der systematischen Analyse eines BRUX CHECKERS® wird die intraindividuelle Beurteilungvorgenommen (Abb. 3).
Abbildung 3: Mit diesem Analyseschritt beginnt bereits die Planung der möglichen therapeutischer Maßnahmen. Es wird traditionell der Fokus auf „große“ und „ins Auge springende“ Abriebstellen gelegt. Viel interessanter sind die nicht verwendeten okklusalen Abschnitte. Danach können die sichtbaren Abriebstellen auf dem BruxChecker® mit den funktionellen Strukturen der okklusalen Morphologie zusammengeführt werden [DRS Element Auswertung]
In diesen 3 Schritten kann ein BRUX CHECKER® zeitsparend und effizient analysiert werden, und gleichzeitig administrative Aufgabe und die Dokumentation unterstützt.
Im nächsten MIND BAR Artikel, der im Rahmen des Newsletters Anfang September erscheint, werden wir uns mit den therapeutischen Konsequenzen bei bruxierenden Patient*innen auseinandersetzen.
Literaturverzeichnis
[1.] Onodera K, Kawagoe T, Sasaguri K, et al. The Use of a BruxChecker in the Evaluation of Different Grinding Patterns During Sleep Bruxism, CRANIO® 2006;24(4):292-9
[2.] Lobbezoo F. et al. International consensus on the assessment of bruxism: Report of a work in progress J Oral Rehabilitation 2018;1-8
[3.] Sateia, MJ International classification of sleep disorders. Chest 2014;146.5:1387-94
[4.] Greven M, Onodera K, Sato S. The use of the BruxChecker® in the evaluation and treatment of bruxism Zeitschrift für Kraniomandibuläre Funktion 2015;7.(3): 1-11
[5.] Reichardt G, Miyakawa Y, Röthele V. Strategische hochkomplexe Rehabilitation mit Zehn-Jahres-Kontrolle ZWL Zahntechnik Wirtschaft Labor 2020;6